




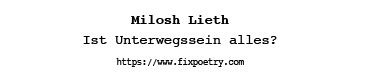
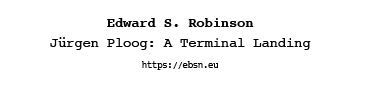
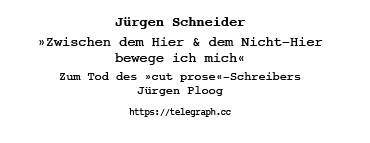
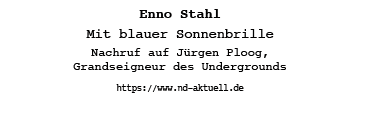
sondern um zu suchen«
/ / / Erinnerung an Jürgen Ploog
Von Wolfgang Rüger
Zuletzt gesehen haben wir uns im August letzten Jahres. Er sah immer noch wie das älter gewordene Double von Brian Ferry aus, gut gekleidet, den Schnellhefter mit seinen Textblättern unterm Arm. Clemens Meyer hatte Jürgen Ploog zu seiner Abschiedslesung als Stadtschreiber von Bergen-Enkheim in die Nikolauskapelle eingeladen. „Cut-up – Lesung und Gespräch“ war der Abend überschrieben. Klar war, daß ich da hinging. Zum einen war es eine seltene Gelegenheit, den alten Freund wiederzusehen, zum anderen hatte ich ein bißchen Angst, daß sonst kaum einer kommen würde. Ploog litt zeitlebens darunter, daß gerade in Frankfurt kein Hahn nach im krähte. In den über 35 Jahren, die wir uns kannten, hat er schätzungsweise keine Handvoll mal in Frankfurt gelesen. Bergen-Enkheim zeigte sich dann aber von seiner besten Seite, die Kapelle war gut gefüllt, und das Ploog-atypische Publikum fühlte sich, soweit ich das beurteilen konnte, gut unterhalten.
Anfang der achtziger Jahre war ich ein blutjunger Verleger, gerade aus der hohenlohischen Provinz als Student nach Marburg gekommen, und schon Veranstalter einer Lesereihe im Café des Buchladens Roter Stern. Eingeladen wurden damals alle literarischen Heroen des deutschsprachigen Undergrounds. Der Größte von allen war Jürgen Ploog. Er war damals schon „ganz ohne Zweifel einer der einflußreichsten sogenannten Subliteraten“ (Florian Vetsch) und genoß in der Alternativszene Kultstatus.
Seit den frühen sechziger Jahren war der in Frankfurt lebende Ploog in der Szene präsent. Zusammen mit Carl Weissner, Udo Breger, Jörg Fauser, Pociao und Walter Hartmann bildete er Ende der Sechziger/Anfang der Siebziger den harten Kern der little mag Szene. Ploog war der einzige deutschsprachige Cut-up-Autor von herausragender und originärer Qualität. Mit seinen Büchern „Cola Hinterland“ (1969), „Die Fickmaschine“ (1970) „Sternzeit 23“ (1975), „Radarorient“ (1976), „Pacific Boulevard“ (1977), „Motel USA“ (1979), „Nächte in Amnesien“ (1980) hat er den Deutschen vorgeführt, was Cut-up ist. Als Mitherausgeber von „Gasolin 23“, dem vielleicht wichtigsten little mag Deutschlands, hat er Maßstäbe gesetzt und Talente gefördert.
Geboren wurde er 1935 in München. 1952 kam er mit dem Schiff zum ersten Mal in die USA, wo er ein Jahr als Austauschschüler in Pittsburgh verbrachte und „eine vollkommen andere Welt“ kennenlernte. Nach dem Abitur begann eine Zeit des Suchens nach einem Beruf, in dem sich künstlerische Tätigkeit und Broterwerb verbinden ließen. Gefunden hat er diesen bei der Lufthansa, für die er 33 Jahre lang als Langstreckenpilot unterwegs war. „Die Fliegerei war die richtige Art und Weise, wie ich mein Leben verbringen konnte.“ Für das zerrissene Leben des Piloten (heute hier, morgen da) fand er in der von William S. Burroughs entwickelten Cut-up-Methode die für ihn am besten geeignete Ausdrucksweise. Fortlaufendes lineares Erzählen war durch die Lebensweise des Piloten nicht möglich. Die harten Schnitte des Cut-up ermöglichten, in der Sprache die Sprünge des Lebens nachvollziehbar zu machen. Seine ersten Texte waren noch vom reinen Cut-up geprägt, wurden dann aber im Lauf der Zeit, analog zur Routine des Fliegens, geschmeidiger und assoziativer, wie er in einem sehenswerten und aufschlußreichen Film von Eliott Ploog, der auf youtube zu sehen ist, selbst zugibt.
Seit den Sechzigern war seine Wohnung im Frankfurter Westend Anlaufpunkt der Frankfurter Boheme. Jörg Fauser hat ihm in seinem autobiographischen Roman „Rohstoff“ unter dem Pseudonym Anatol Stern ein literarisches Denkmal gesetzt: „Manchmal ging ich nach Feierabend zu Anatol Stern. Er lebte mit Frau und Tochter im Westend. Stern war von Hauptberuf Pilot, das Schreiben erledigte er nebenher, meistens in den Hotels, in denen die Crews abstiegen, in Karachi, Bombay, Bangkok, New York, Los Angeles, Rio. Seine Frau war außerordentlich attraktiv und gastfreundlich. Es schienen eine Menge Hippies und Junkies in der Wohnung zu verkehren, aber nach und nach bekam ich mit, dass es Literaturstudenten waren, Models, Boutiquenbesitzerinnen, Künstler, Autoren.“
Mitte der Achtziger kam ich nach Frankfurt, stieg schnell zum leitenden Feuilletonredakteur der Stadtzeitschrift Auftritt, später Journal Frankfurt, auf und versammelte alle mir wichtigen Autoren um mich. Der intelligenteste Kopf unter ihnen war Jürgen Ploog. Wie kein anderer im deutschsprachigen Raum hat er in seinen Essays die Literatur aus den Randzonen gleichsam programmatisch und prophetisch analysiert, kommentiert und kritisiert. Unter dem Titel „Facts of Fiction, Essays zur Gegenwartsliteratur“ sind seine besten Essays versammelt. Am Beispiel von William S. Burroughs, Kathy Acker, Carlos Castaneda, Sam Shepard, Joseph Conrad und Rolf Dieter Brinkmann setzt er sich mit der Zukunft der Literatur auseinander.
Jahrzehntelang war er Verfechter und Vordenker einer Literatur, die in ihrem Bewußtsein mit den Transformationen der Lebenswelt Schritt halten kann. „Veränderungen in der Landschaft der Wahrnehmung werden Veränderungen in ihrer Darstellung nach sich ziehen. Ja. Aber das ist nur die handwerkliche Voraussetzung, die eigentliche Arbeit des Schreibers ist, über die Abenteuer, denen Bewußtsein ständig ausgesetzt ist, zu berichten, die noch nicht Allgemeingut gewordenen Erfahrungen/Wahrnehmungen dingfest zu machen, sie fiktiv durchzuspielen.“
Sein Werk umfaßt heute 35 Einzelpublikationen, alle veröffentlich in Klein- und Kleinstverlagen, vom etablierten Feuilleton praktisch nicht zur Kenntnis genommen. Er war der sprichwörtliche Prophet, der im eigenen Land nichts gilt.
In den zehn Jahren meines Journalistendaseins hatten wir intensiv miteinander zu tun. Ab der Jahrtausendwende trafen wir uns nur noch sporadisch. Er war als Pilot pensioniert, ich wurde Antiquar. Vom Heuschnupfen geplagt, verschwand er immer am Anfang des Jahres für mehrere Monate nach Florida, wo er einen zweiten Wohnsitz hatte. Piloten gehen berufsbedingt früh in Rente, ihm blieb jetzt viel Zeit für die Familie und zum Schreiben. Sein Freund Wondratschek hat das vor einem halben Jahr so formuliert: „Ich habe ihn dort einmal besucht. Und sah, was ich kenne: Jürgen an der Schreibmaschine. … Nun wird der Altmeister, der Freund, der Autor, Essayist und Theoretiker, unglaubliche 85 Jahre. Ein, wie es für einen Mann seiner Statur gehört, sturer Hund, der seine in den späten sechziger Jahren begonnene Pionierarbeit ohne erkennbare Ermüdung bis heute fortsetzt.“
Obwohl er kontinuierlich publiziert hat, in Insiderkreisen verehrt wird, ist er doch der wahrscheinlich unbekannteste Große in der deutschsprachigen Literatur der zweiten Jahrhunderthälfte geblieben. In der Schweiz und in den USA hatte er noch die größte Reputation und Fangemeinde.
Auf meine Geburtstagsmail im Januar gab er mir schon keine Antwort mehr. Über Dritte hörte ich von einer schweren Herzoperation. Das Herz hat ihn jetzt im Stich gelassen. Aus der Schweiz höre ich, daß über 60 Namen aus der weltweiten Literaturszene auf seiner Traueranzeige genannt werden möchten.
Für eine Entdeckung ist es nie zu spät. Auch postum könnte man dem Werk dieses Autors die ihm gebührende Anerkennung verschaffen. Neugierigen empfehle ich zum Einstieg einen Klick auf www.ploog.com. Wenigstens das Internet macht ihn unsterblich.
+ + +
„Ist Unterwegssein alles?“
/ / / Zum Tod von Jürgen Ploog
Von Milosh Lieth
Immer wieder habe ich versucht, in der Prosa Jürgen Ploogs zu versinken. Immer wieder bin ich gescheitert. Was der erste Grund ist, warum ich sein Werk achte wie kaum ein zweites. Hier allerdings von einem Nachruf zu sprechen, wäre vermessen. Ich war mit Jürgen Ploog nicht bekannt. Bei dem folgenden handelt es sich eher um einen Aufruf, sein Werk mit in die Zukunft zu nehmen.
***
Die letzte Szene in Jean-Luc Godards Film Le Mépris: Paul Javal, der die Dreharbeiten zu einer Verfilmung der Odyssee begleitet und dabei die Liebe seiner Frau Camille verliert, kehrt ein letztes Mal an das Filmset zurück. Er trifft dort den Drehbuchautoren Fritz Lang bei den Arbeiten an jener Szene, da der heimkehrende Odysseus zum ersten Mal wieder sein Vaterland, Ithaka, sieht. Bevor der Vorhang sich schließt, sieht der Zuschauer Odysseus, die Arme emporgestreckt, den Blick über das Meer auf seine Heimat gerichtet. Gerade weil die Kadrierung hier das Off des Filmsets einschließt, damit die Gemachtheit der Darstellung ausstellt, entlarvt sie die Geste des Odysseus als eine für die Gegenwart verlorene Filmstudio-Nostalgie. Man könnte von einer Dekonstruktion der heroischen Ankunft sprechen. Was zugleich ein Ausblick ist: Paul, der mit Camille auch seine Verwurzlung im Alltäglichen verloren hat, wird das Glück des Odysseus, der in seine Heimat zurückfindet, nicht wiederholen können. Eine der Fragen, die Godard in Le Mépris aufwirft, betrifft genau diesen Punkt: ob der Mensch, einmal aus den eigenen Bewandtniszusammenhängen gerissen, als Odysseus ohne Hafen auf ewig zum ziel- und planlosen Umherstolpern verdammt ist. Man könnte das gesamte Werk Jürgen Ploogs als Versuch begreifen, diese Frage Godards zu beantworten.
***
Die wichtigste Voraussetzung von Ploogs Schreiben war immer die Einsicht, dass Sprache ein höchst heimtückisches Erkenntnisinstrument ist. Heimtückisch, weil sie immer kontaminiert ist, von außer- wie innersprachlichen Normen, von Alltagsideologie, von Wissensdispositiven, von Kompromissen – eben von der Kehrseite dessen, was wir Kultur zu nennen gewohnt sind. Subliminale Kontrolle nannte Ploog das. Sie verhindert den Blick auf eine Welt im Werden, eine Welt, geprägt vom Diskontinuierlichen, in der ein Bild niemals Abbild, sondern immer zugleich sein eigenes Urbild ist. Wer sich allzu häuslich in der Sprache einrichtet, wer sesshaft in Begriffen wird, verstellt sich damit den Blick auf die Einzigartigkeit eines jeden Augenblicks und Vorgangs. In seinem Werk setzte Ploog diesem leichtfertigen Verfahren mit Sprache und Welt eine andere, eine nomadische Subjektivität entgegen. Ein zeitloser Entwurf.
***
Jürgen Ploog, geboren 1935, ist am vergangenen Dienstag im Alter von 85 Jahren in Frankfurt verstorben, wo er seit 1960 lebte. Erstmals auf die literarische Bildfläche trat er in den frühen 60er Jahren, als er die von Brion Gysin entwickelte Cut-Up-Methode übernahm, sie ausarbeitete und 1969 mit dem Roman Cola-Hinterland ein in der deutschen Sprache einzigartiges Zeugnis dieser Technik schuf. Bekannter wurde Cut-Up durch den amerikanischen Schriftsteller William S. Burroughs, dessen transatlantischer Komplize Ploog wurde und, wichtiger: dessen Werk Ploog in den Strassen des Zufalls (1983) umfangreich kommentierte. Selten ist so konzentriert über das Schreiben geschrieben worden. Überhaupt ist das essayistische Werk Ploogs eines der besten mir bekannten.
Bei der Cut-Up-Methode handelt es sich um ein radikales Formexperiment, bei der Texte zerschnitten werden, um die Satzschnipsel anschließend neu zusammenzusetzen – was entsteht ist eine Art Collage, die das Diskontinuierliche und perspektivisch Uneindeutige reflektiert, dem sich Ploog in seinem Beruf als Linienpilot in besonderer Weise ausgesetzt sah, die aber auch Vernetzungen und Wucherungen als neue Möglichkeiten begreift, mit einer zunehmend rasanten und bodenlosen Wirklichkeit umzugehen. Arbeit an der Sprache als Arbeit am Bewusstsein: Satzschnipsel aus ihren syntaktischen und paradigmatischen Zusammenhängen reißen, um ihnen eine andere, eine dritte Wahrheit zu entlocken. Das heißt eben auch: sich selbst für unabgeschlossen erklären, sich als Experiment in immer neuen Versuchsanordnungen begreifen.
Natürlich könnte man geneigt sein, im literarischen Produkt dieser technisch anmutenden Theorie nichts als Gestammel zu sehen. Man könnte darin aber auch den Versuch sehen, höchste sprachlich Genauigkeit zu erreichen, gerade weil das Bezeichnete sich einer syntaktisch schlüssigen Bezeichnung widersetzt. Es ging darum, eine Sprache zu schaffen, die sich an der eigenen Wahrnehmung orientiert und gleichzeitig dem Scherbenhaufen von Welt gerecht wird, der sich dieser Wahrnehmung bot.
***
Im Laufe seines literarischen Wirkens ließ Ploog die Cut-Up-Technik zusehends hinter sich und orientierte sich stärker an einem episodischen Darstellungsverfahren. Resignation? Zugeständnisse ans Publikum? Mitnichten. Analog zu dem, was Ploog einmal über die Cut-Up-Methode gesagt hat, könnte man formulieren: Der episodische Schnitt zerlegt das Textgefüge (statt dem Satzgefüge) in ein Punktsystem. Der Schnitt ist nicht aus seinem Werk verschwunden, er hat sich bloß verschoben.
Einer der interessantesten Texte aus jener späten Schaffensphase Ploogs ist Unterwegssein ist alles, erschienen 2011 im [sic]-Verlag, versehen mit dem Untertitel Nomadische Statements. Wir folgen einem weitestgehend anonymen Reisenden durch eine weitestgehend anonyme Topographie, und, viel entscheidender: den zwei Aggregatszuständen seines Bewusstseins.
Da ist einmal das, was Ploog Nicht-Hier genannt hat. Es ist schwer, diesen Zustand zu beschreiben, weil er im Text nur durch die Abwesenheit von Sprache, nur durch die Lücken zwischen den Episoden greifbar ist. Am ehesten handelt es sich dabei um einen Zustand der sprachlichen (das heißt auch: mentalen) Durchlässigkeit, der bevorzugt dann eintritt, wenn der Reisende sich von einem Ort zum anderen bewegt. Ob mit dem Auto, dem Flugzeug oder wie auch immer – darüber schweigt der Text sich aus. Sicherlich steht die fehlende Sprache hier aber in einer engen Verbindung zu der erlebten Beschleunigung, der sich der Reisende ausgesetzt sieht. Die Szenerie flieht zu schnell, zu verzerrt am Auge vorüber, um sie ohne Rückgriff auf Projektionen tatsächlich zu sehen. Im Notfall muss im Namen der sprachlichen Präzision die Sprache verschwinden. Gleichzeitig aber handelt es sich bei dem Nicht-Hier um eine Notwendigkeit, die sich aus den Tücken des anderen Zustands, des Hier, ergibt.
An einer Stelle beschreibt Ploog das Auftauchen aus der Versenkung, die Konversion ins Hier als Schritt aus dem Schatten. Allerdings nicht im Sinne eines aufklärerischen Erleuchtungs-Topos, sondern viel eher beschreibt Ploog sie als Geste der Auslieferung. Der Moment, wenn der Reisende aus dem petit mort seines Bewusstseins auftaucht, sich der Welt zuwendet, ist gleichzeitig der Augenblick seiner größten Verwundbarkeit. Denn im Hier alphabetisiert sich die Welt im Bewusstsein des Reisenden, sie wird wieder sprachlich, und daher angreifbar für die richtenden und lenkenden Mechanismen, die in seinem anerzogenen Gedächtnis wirken – ein Prozess, der viele tatsächliche und/oder vermeintliche Vertreter postmodernen Subjekttheorie inspirierte, vom verschwundenen, unterworfenen Subjekt zu sprechen. Daher spricht Ploog von der Notwendigkeit einer „punktuellen Wahrnehmung“: sich nie lange genug im Hier aufhalten, um in die tradierten Assoziationsketten zu geraten, die das Subjekt zum Automaten degradieren.
Diese Reise zwischen den Wahrnehmungs- und Sprachinseln, das Oszillieren zwischen Hier und Nicht-Hier ist es, was man die nomadische Subjektivität Ploogs nennen könnte. Es muss hier überhaupt nicht kümmern, inwiefern die Figur des Nomaden in der Kulturtheorie eine kopernikanische Wende vom ärgerlichen Krawallmacher zur – im positiven Sinne – subversiven, anarchischen Gestalt absolviert hat. Es ist selbsterklärend, dass Ploog seinen Platz in dieser geisteswissenschaftlichen Tradition hat. Viel wichtiger ist aber, dass Ploog mit seinem Schreiben dieser nomadischen Subjektivität eine literarische Ausdrucksform gegeben hat.
***
Das Werk Ploogs zwingt zu zwei Feststellungen: wir alle sind der Lebensform nach Nomaden im einfachsten Sinne des Wortes geworden – durch unsere Unrast, durch unser Erleben einer polyphonen Welt, durch unsere zunehmende Heimatlosigkeit. Und, das wäre die zweite Feststellung: wir alle neigen noch immer dazu, die Welt durch die Augen des Sesshaften zu sehen. Wenn wir von uns und der Welt erzählen, erzählen wir in Linien, nicht in Punkten. Deswegen Ploogs unermüdliche Forderung, die eigene Sehweise zu überprüfen.
Zu Beginn habe ich gestanden, in seiner Prosa nie versunken zu sein. Damit war gemeint: es ist schwer, sich stundenlang in seinem Werk aufzuhalten, eines seiner Bücher ohne Unterbrechungen zu lesen. Denn Jürgen Ploog forderte seine Leser, durch die eruptive Form, aber auch durch seinen Mut zum sperrigen Wort. Immer wieder bin ich etwa in seinem Roman Undercover von 2005 auf das vermeintliche Verwirrspiel hereingefallen und habe mich gefragt, wo in aller Welt die Verbindungslinien bestehen, wo sich der Protagonist gerade aufhält, wo Ende, wo Anfang sind. Kurz: ich habe dieses nomadische Werk mit der Gewohnheit des Sesshaften gelesen. Hier muss alle Auseinandersetzung mit Ploogs Werk beginnen. Nämlich nicht nur zu fragen, wie mit dieser Bodenlosigkeit umzugehen ist, sondern sie auch als Möglichkeit zu begreifen, neu zu sehen und zu fühlen. Darin nämlich besteht auch Ploogs Antwort auf die Frage Godards: Der Ausbruch aus den gewohnten Bewandtniszusammenhängen muss weder blindes Umherstolpern noch Eskapismus bedeuten, sondern kann zur faszinierenden Möglichkeit werden, Welt zu erleben.
+ + +
»Zwischen dem Hier & dem Nicht-Hier
bewege ich mich«
/ / / Zum Tod des »cut prose«-Schreibers
/ / / Jürgen Ploog
Von Jürgen Schneider
Jürgen Ploog wurde 1935 in München geboren. Nach einer Ausbildung zum Gebrauchsgrafiker war er drei Jahrzehnte als Langstreckenpilot unterwegs und versuchte mit dem Schnittverfahren »Cut-up« den Viruscharakter des Wortes bloß zu stellen: »Das Wort sehen & betrachten, es zum Material machen wie der Maler Form oder Farbe behandelt, bis sie möglichst deckungsgleich seiner Vorstellung entsprechen.«
In einem Interview, veröffentlicht in Poet (Nr. 21, Herbst 2016), erklärte Ploog: »Cut-up ist ein Versuch, gegen den Strich zu schreiben und lebt von Experimentierfreude. Eine Versuchsanordnung, die der Jagd nach dem Zufall dient. Dahinter steckt eine Art Quantentheorie des Worts. Was soviel heißt wie ein verändertes Verhältnis zum Wort herstellen. Denn was bedeutet Schreiben, wenn es nicht nur der Unterhaltung dient? Aber die Literatur schottet sich ab, wird dirigiert von geheimen Geistern wie Kritikern, Lektoren, Agenten und Verlegern. Von Faktoren, die mit Literatur wenig zu tun haben. Und da steht der Schriftsteller und versucht, es allen recht zu machen. Anstatt aufzustehen, wie Brinkmann, und zu sagen: Euch gibt es gar nicht. – Ich fordere den autonomen Autor, der sich erst einmal hemmungslos umsieht (dabei kann er auch in einem Café sitzen). Und dann versucht, seiner Sichtweise eine sprachliche Form zu geben.«
Ploogs Experimente mit Cut-up-Techniken führten früh zu einem regen Austausch mit William S. Burroughs, dem Autor von Naked Lunch und anderen Werken, die der Trübe-Tassen-Literatur Paroli bieten. Ploog gründete mit Carl Weissner und Jörg Fauser die legendäre Literaturzeitschrift Gasolin 23 und war Schreiber von mehr als zwanzig Büchern.
Ich kannte Jürgen Ploog seit den 1980er Jahren. Als ich ihn Ende des letzten Jahres zu einer Lesung in Düsseldorf einlud und ihm schilderte, warum diese in den von meiner Lebensgefährtin und mir bewohnten Räumen stattfinden würde – Düsseldorf ist eine literarische Wüstenei –antwortete er:
»Lieber Jürgen,
Ja, du versuchst, eine temporär befreite Zone hinzukriegen. Da bist du auf dem richtigen Weg & verdienst Unterstützung. Trotzdem kann ich mich nicht zu einer Zusage entschließen. Ich mag mich unter bestehenden Verhältnissen (die du ja in deiner Mail plastisch beschreibst) nicht exponieren. Ich käme mir vor wie auf einer Alibiveranstaltung mit déjà vu-Anwandlungen vor. Das ist eine Plattform für Jüngere. Das sage ich mit einem feuchten Auge. Auch weil mir damit eine Begegnung mit dir entgeht.«
Am 19. Mai 2020 ist Jürgen Ploog gestorben.
+ + +
Jürgen Ploog: A Terminal Landing
By Edward S. Robinson
Jan Herman wrote that Jürgen Ploog ‘was widely regarded as one of Germany’s premiere second-generation Beat writers’, going on to observe that ‘his narrative fiction—like that of William S. Burroughs, a mentor with whom he was associated—was more experimental and closer to Brion Gysin’s or J.G. Ballard’s than to Jack Kerouac’s or Allen Ginsberg’s’.
Ploog’s reputation beyond his native Germany is perhaps limited to just a couple of things: his hour-long interview with William S. Burroughs which featured on Klaus Maeck’s documentary Commissioner of Sewers, and his 2008 English-language novella, Flesh Film. However, this presents an extremely reductive perspective of a literary career that spanned some six decades. As such, the news of his death on 19th May 2020 represents a sad loss to the Beat community.
Appreciation of the ‘European Beats’, the second generation of writers who took their cue from Burroughs’ Nova trilogy has been slow in coming and somewhat sparse: it’s only post-millennium and with the advent of a renewed interest and what might be considered as a net-based third generation that their significance has come to be given fair appraisal.
On a personal level – and it seems reasonable, since it’s on a personal level that we all process losses – these two things have a particular degree of connection: it was as a fan and scholar of Burroughs, at the beginning of a doctoral thesis in 1999, that I found Commissioner of Sewers, and was particularly taken with Ploog’s direct and intelligent questioning of the author. But this was not simply an interview, but a conversation between associates: with contact between the two dating back to the 70s (there are some great archive photos of a young-looking Jürgen Ploog and even a relatively young-looking Burroughs from 1976: Ploog would have been 41, Burroughs 62).
Just short of a decade later, I provided the introduction to Flesh Film, published on-line through The Reality Studio, and a further decade later, a segment of that introduction would appear on the flaps of the dust jacket of the print edition, which truly did Ploog’s unique artistry justice, with the text interspersed with a number of his visual collages.
In between, I had the good fortune of corresponding with him while researching Shift Linguals. Not only did he provide detailed insight into his own writing methods, but also his thoughts on the application of the cut-up method more broadly. More than this, he was generous with his support and encouragement for my project, as well as correcting me on a few points and offering suggestions. As a novice fumbling to find my way in a vast and difficult field, I was immensely grateful, and always will be.
I would also discover the wealth of writing he had done since 1961, particularly as an early adopter of the cut-ups as devised by Burroughs and Gysin in 1959, not least of all Cut Up or Shut Up, the three-way collaboration between himself, Jan Herman, and Carl Weissner, published in 1972. The late 60s and early 70s were something of a wave-crest for cut-ups in Europe, with the publication of Claude Pélieu’s With Revolvers Aimed ... Finger Bowls (1967), and Carl Weissner’s The Braille Film (1970), as well as the emergence of Weissner’s magazine Klactoveedsedsteen, which ran from June 1965 to the autumn of 1967, culminating the seminal Klacto/23 International, UFO, and Gasolin 23, the latter two mags being produced in collaboration between Weissner, Ploog, and Jörg Fauser, with Gasolin 23 running sporadically between 1971 and 1986.
The Reality Studio piece on Gasolin 23 observes that ‘As with Klacto, Gasolin 23 was notable for its experimentalism and its quality roster of contributors, which included William S. Burroughs, Charles Bukowski, Allen Ginsberg, Andy Warhol, and many other notable writers drawn from the international vanguard’.
As such, Jürgen Ploog was a key figure in bringing the cut-ups to Europe, and, perhaps more significantly, propagating the method in the way Burroughs espoused at the time, when he wrote ‘Cut-ups are for everyone ... Anybody can make cut-ups. It is experimental in the sense of being something to do” (The Third Mind: 31). In the summer of 1960, Burroughs wrote to publisher Dave Hazelwood concerning The Exterminator, the follow-up to Minutes To Go: “I think you realize how explosive the material is [...] Are you willing and able to publish – To put it in the street? Please answer at once. Minutes to go believe me”. “To put it in the street” was vital to Burroughs’ strategy for the cut-up assault on the invisible forces of control. Ploog was at the forefront of the resistance movement against the tyranny of language control, not only creating, but circulating work that ‘cut through the mutter lines’.
Ploog’s own first major publication, Cola-Hinterland was published in 1969, but its availability only in German is likely to have limited its wider appreciation. He would later appraise this work critically, describing it as ‘early cut-ups in rather crude form (as first cut-ups are). Using language as material with little regard for plot or readability.’ However, the English-language Cut Up or Shut Up (which featured an ‘introduction’ by Burroughs which ran as a ‘tickertape’ across the top of every page) was something special. A true adoption of the ‘third mind’ principle Burroughs spoke and wrote of in such detail and at length, the text sees the authors meld seamlessly into one cut-up voice, in what still stands as one of the most impressive and exciting cut-up collaborations in print.
In an email to me in 2007, Jürgen explained his first encounters with the cut-ups had been through underground publications in the early 1960s, and how the method subsequently came to define his own work:
In 1958 I started training to become an airline pilot. At that stage I was interested in travelling & my writing was influenced by Kerouac’s. After starting to fly regularly, I noticed that I could not continue in the fluid continuity of Kerouac’s narrative. My life consisted of interruptions both geographically (outwardly) & psychologically (state of mind). Being in different countries constantly plus jet-lagged changed my outlook on the (my) world. In other words: I found out that life indeed is a cut up & needed to find a way of adjusting my writing accordingly.
For Ploog, his day-job and his literary career were closely interconnected, and it would be a fair summary to say that he was very much as much an airline pilot as a writer, and that if his experience of travel informed his writing, then his writing equally provided a means of understanding that experience. ‘I often wonder what the cut-up technique does to the writer’s mind over a period of time, & if it has the same effect on the reader,’ he speculated.
As his measured and self-critical approach to his writing demonstrated, Jürgen Ploog was continually refining his method, and was transparent in acknowledging that cut-ups require work, and don’t simply fall into place: ‘Like Burroughs I edit my work’.
How random is random? I tell you its [sic] is not very random. It tells me what to write about & how. It sets the tone for where I want to go in my writing. Randomness is a major factor in my writing. I have little control over what material I use when I sit down to write. Usually I don’t know what I will write about when I start to write (generally speaking it is the same way to this day). I feel this gets the best results. The material can later be shifted, rearranged, cut out or expanded. Often I re-write older pieces because I feel they have to be clarified or provided with more detail. So random is only the first step but the results are in no way binding or have to be left untouched.
This refinement reached its peak with Flesh Film, a cut-up novella that combined abstraction and pulpiness to potent effect. This was a text that transcended technique for technique’s sake, and hauled the reader along on an intense journey. If one thing should be associated with Jürgen Ploog, it’s the importance of the journey: that sense of movement, of temporal dislocation.
That the book was written in English (with sections originally written in German translated expertly by Carl Weissner) not only meant that it had a wider appeal and accessibility, but was also a factor in its sublime quality. ‘My feeling’, he wrote, ‘is that Cut-up is easier in English (as in comparison with German) because English is more flexible & semantically not so determined.’
Words can easily take on different meanings. This fact poses a difficulty with translation. The semantic diversion cannot be transcribed without using other words, meanings, situations. I can write (with limitations) English texts when using the cut-up method which I could not do without it.
This keen interest and awareness of language and its malleability was what made Jürgen Ploog such a strong exponent of the cut-ups. The attention to detail, to the nuances of meaning, but also being alive to the effects of juxtaposition and incongruity, was not only the outward demonstration of a keen intellect, but someone avidly devoted to the development of his craft. He was also acutely aware of the barriers presented by language, as well as the way translation can ‘mutate’ interpretation:
As for the effect on verbal control mechanisms, the translation will not hamper it since it is the “spiral” use of words that carries it. The main thing is the “anti-semantic” use of words which is there in the original (to a large extent) also in the translation. But in general a translation is always just an attempt to create the same version of expression in another language.
Everything is a version of something else, and the gap between language and perception remains a challenge to any author. However, over the course of his career, Jürgen Ploog strove to create writing that was closer to the perception of life as lived, ad to convey the disorientation of postmodern existence. You don’t need to be in eternal transit for this to be relatable: flicking through TV channels is a global journey that can be undertaken in seconds without moving an inch. We’re nowhere near having evolved to deal with this, but through his writing Jürgen Ploog devised a mode of writing that created some kind of bridge between experience and expression. As a literary legacy, it’s no small feat.
So while we mourn the loss, and the arrival at this final destination, we should be sure to celebrate the journey.
+ + +
Mit blauer Sonnenbrille
/ / / Nachruf auf Jürgen Ploog,
/ / / Grandseigneur des Undergrounds
Von Enno Stahl
Er war so etwas wie der letzte Protagonist des bundesdeutschen Literaturuntergrunds. Nach dem frühen Tod von Jörg Fauser 1987, dem von Hadayatullah Hübsch 2011 und ein Jahr später von Carl Weissner war Jürgen Ploog als Einziger aus jener berühmten Gruppe übrig geblieben, die einst in Frankfurt am Main Ausgangspunkt und Herz der deutschen Beat-Literatur war.
In Frankfurt lernte ich Ploog vor 32 Jahren kennen, beim sagenumwobenen »60/90-Treffen« deutscher Independent-Autoren im Mousonturm. Ich war 25 Jahre alt, am Morgen aus New York gekommen und aufgewühlt von den Erlebnissen eines dreiwöchigen Aufenthalts in der damaligen Kulturhauptstadt der Welt. Das »60/90-Treffen«, gedacht als Brückenschlag zwischen den Pop- und Untergrundautoren der 60er Jahre und den jüngeren Schreibern der beginnenden 90er Jahre mit ähnlich geartetem Interessensportfolio, erschien mir ausgesprochen lahm. Etwa 30 Leute saßen gelangweilt im Kreis, weder kam eine echte Diskussion auf, noch gab es ernsthafte Ideen für eine Kooperation. Alles in allem enttäuschend, auch wenn ich heute weiß, dass am Vorabend eine Marathonlesung stattgefunden hatte, von der noch alle ziemlich erschöpft waren.
Einen Brückenschlag gab es dennoch, ein paar der Anwesenden begründeten wenig später den »Social Beat« als neue literarische Bewegung. Und ich persönlich traf erstmals auf Jürgen Ploog, nach dem offiziellen Part im Café des Mousonturms. Er war eine beeindruckende Figur, tadellos gekleidet, wie auch später immer; indes trug er eine blaue Sonnenbrille, als einziges Insigne dafür, dass man keinen Vertreter des Großbürgertums vor sich hatte, sondern einen Querschreiber von Rang. Beeindruckend war auch seine intellektuelle Bandbreite. Anders als die Leute, die ich im Mousonturm erlebt hatte, war er auf dem Stand der damals aktuellsten Theorien, sprach über Paul Virilio und Jean Baudrillard, über die er später auch verschiedentlich essayistische Pamphlete veröffentlichte.
Natürlich war Ploog zu diesem Zeitpunkt längst eine Legende - durch die Herausgabe von »Gasolin 23«, der einzigen deutschen Underground-Literaturzeitschrift von bleibendem Wert, zumal seine Mitstreiter dabei Jörg Fauser und Carl Weissner gewesen waren. Natürlich auch durch seine Bekanntschaft mit William S. Burroughs, der in der 80er Jahren geradezu die Ikone eines Schreibens war, das der blutleeren, erklügelten Langweilerliteratur in Deutschland diametral entgegenstand. Burroughs war für Ploog immer ein Leuchtfeuer gewesen, an dem er sich orientierte. In allen seinen Prosaschriften bediente er sich jener Cut-up-Methode, die Brion Gysin Ende der 50er Jahre in Paris erfunden hatte und die Burroughs mit seinen Büchern dann weltbekannt machte: das Verfahren, das eigene und fremde Texte assoziativ miteinander verschränkt, indem man die Seiten von Texten zerschneidet und neu zusammensetzt. Ploog sagte in einem Interview, das ich 2005 mit ihm führte: »Ich denke, der Autor tritt durch diese Methode aus seiner psychologischen Identität, aus Bewusstseinsräumen, die nicht im Realen angesiedelt sind, vielleicht im Unbewussten. Hier werden die Türen geöffnet, dem Zufall oder dem Unwahrscheinlichen Zutritt zur Gestaltung verschafft.« Für Ploog hatte die Cut-up-Methode aber noch eine ganz eigene, persönliche Bedeutung, denn er war neben dem Schreiben 33 Jahre als Langstreckenpilot tätig. Die Zeit- und Raumsprünge, die Cut-ups in der Literatur leicht ermöglichen, sind ihm so zu einer zweiten Existenz geworden.
Sein Debütband »Cola-Hinterland« erschien 1969 als die erste, originäre Einzelpublikation des deutschen Literaturuntergrunds, heute ebenso legendär wie vergriffen. Der Text spart nicht mit sexuellen Konnotationen und Kraftausdrücken, sie stellen vielmehr eine prägnante Spur im stark geschnittenen Sprachstrom dar (»Ich bin in Cuntsville in ihr Kommunikations-System geraten // atomare Fotzen-Medien«). Es sind dies zeittypische Provokationen, bewusst dem bürgerlichen Literaturbetrieb entgegengeworfen. In der durchweg prüden BRD der 60er Jahre war das die effektivste und daher die bevorzugte Angriffsform; sexistische Tendenzen sind dennoch unübersehbar. Ein gewisser männlicher Chauvinismus wurde Ploog auch später hier und da vorgeworfen. Er selbst konnte das nicht verstehen, aber er schätzte Frauen sehr, die sich offen mit ihm darüber auseinandersetzten.
So ein literarisches Outlawtum hat in Deutschland allerdings seinen Preis - während man in Frankreich in dieser Pose von den Medien durchaus hofiert werden kann, schweigen sie einen hierzulande einfach tot. Ploog konnte zeitlebens nur in kleinen, oft kurzlebigen Untergrund-Verlagen publizieren, die verdiente Anerkennung blieb ihm so weitgehend versagt. Doch diese Missachtung mehrte in subliterarischen Kreisen seinen Ruhm umso mehr. Zudem bot seine Literatur mit ihren zeitlichen und räumlichen Schnitten Anknüpfungspunkte für Medien- und Kunstprojekte, ein Ergebnis war der Dokumentarfilm »Die Cut-up-Connection« (1997) von Daniel Guthmann und Raoul Erdmann.
Ploogs literarisches Werk wurde 2004 im Vorfeld seines 70. Geburtstags in dem umfangreichen Sammelband »Tanker« gewürdigt, herausgegeben von Florian Vetsch. Dieses Werk ist leider nicht einmal mehr antiquarisch erhältlich, ebenso wenig wie viele andere Veröffentlichungen Ploogs. Bei Amazon heißt es sowieso durch die Reihe: »Derzeit nicht verfügbar«. Doch zum Glück hat der stets rührige Peter-Engstler-Verlag ebenso wie Ralf Friels Moloko-Print eine ganze Reihe von Ploogs Büchern und Booklets im Programm, ja, es sind sogar neue Veröffentlichungen bei beiden Editionen angekündigt.
Nun ist er, mit 85 Jahren, von uns gegangen - der Grandseigneur des deutschen Undergrounds. Bei aller Ablehnung des konservativen Literatur-Establishments, das ihn so beharrlich ignoriert hat, und trotz seiner meilenweiten Distanz zur bürgerlichen Literaturauffassung schätzte er die gehobene Küche. In Restaurants beschwerte er sich nachdrücklich, wenn ihm dabei etwas nicht passte. Und er war sogar Mitglied bei den Rotariern. Widersprüche gehören eben zur Persönlichkeit großer Autoren - und ein solcher, die Zeit wird es zeigen, war Jürgen Ploog.
+ + +